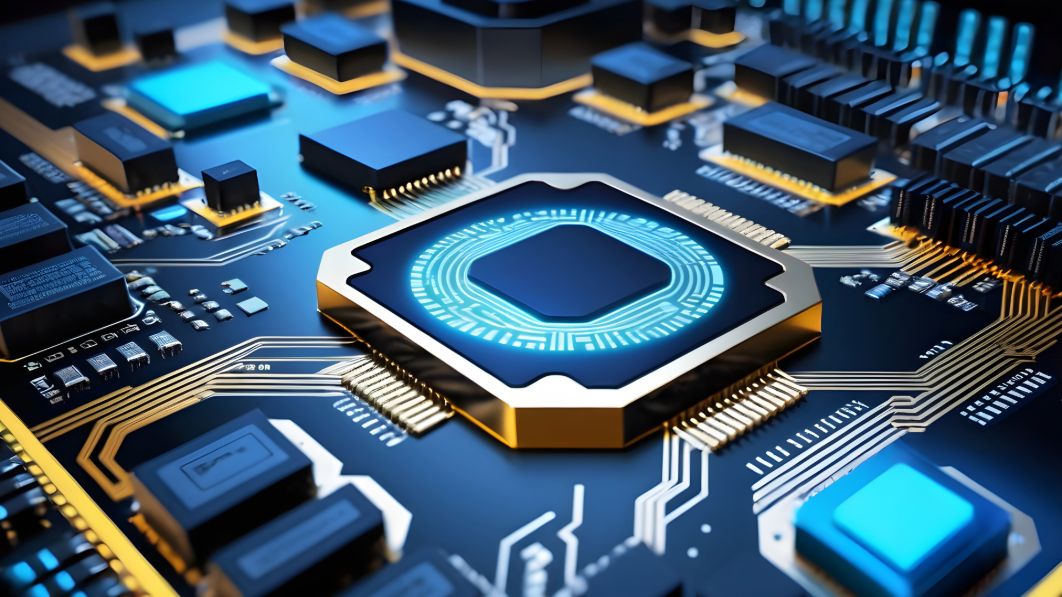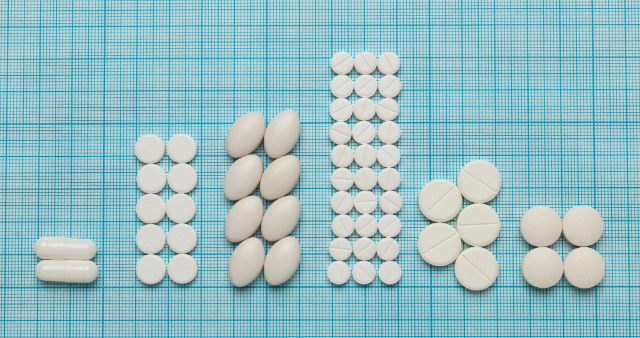Fortschritte im Bereich Künstlicher Intelligenz befördern die Kurse von Technologieaktien auf anspruchsvolle Niveaus. Was ist in Zukunft möglich? Eine Szenarioanalyse.
Die Teilnehmer am Aktienmarkt haben in den letzten Monaten unter dem Strich entschieden, das politische Getöse aus Washington weitgehend auszublenden. Dies mag für viele Beobachter sorglos wirken, könnte sich aber wie so oft in der Vergangenheit schlicht als realistischer Pragmatismus herausstellen. Getreu dem Motto: „Politische Börsen haben kurze Beine.“
Möglicherweise werden aber auch berechtigte Sorgen von der großen Euphorie um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) überlagert. Bereits heute stützt der Investitionsboom in diesem Bereich nicht nur die US-Wirtschaft, er verhilft auch zahlreichen Unternehmen zu Rekordgewinnen. In diesem „Goldrausch“ feiert der Aktienmarkt sowohl die unmittelbaren Profiteure – also im übertragenen Sinne die Ausrüster des Booms, die sozusagen Schaufeln und Picken herstellen – als auch die Goldgräber selbst, die im KI-Hype zunächst erstmal zig oder gar hunderte von Milliarden investieren wollen.
Was kann KI leisten?
Dieser Hype weckt bei vielen böse Erinnerungen. Warnungen vor einer KI-Blase sind fast täglich zu lesen, genährt auch von alarmierenden Vorzeichen wie Kreuzbeteiligungen und zirkulären Geldflüssen oder teils extremen Aktienkursbewegungen. Für den Kapitalmarkt wird aber am Ende entscheidend sein, wie viel „Gold“ tatsächlich gefunden wird – also, was KI leisten kann. Dies wird bestimmen, inwiefern sich die enormen Investitionen am Ende tatsächlich in Gewinne ummünzen lassen und wie tiefgreifend die Auswirkungen auf Volkswirtschaften und Unternehmensgewinne ausfallen.
In einem groben Gedankenspiel könnte man dafür drei Szenarien entwerfen:
1. Übermenschlich: Der Fortschritt von KI-Modellen setzt sich in exponentieller Form fort. Sie werden immer klüger und zuverlässiger und sind bald den meisten Menschen bei immer mehr intellektuellen Aufgaben überlegen. Bereits in wenigen Jahren werden Millionen von Bürojobs von KI-Lösungen wie beispielsweise Agenten übernommen, immer mehr Prozesse laufen vollautomatisiert. Auch in der physischen Welt – beispielsweise im Straßenverkehr oder in Fabriken – können smarte Systeme mithilfe von KI zunehmend autonom agieren.
2. Gewöhnlich: Analog zu früheren, großen technologischen Innovationen wie der Elektrizität oder dem Internet, wird auch die KI die Wirtschaft und Gesellschaft tiefgreifend prägen und dabei ihre Fähigkeiten zunehmend ausbauen. Allerdings bleibt die Überlegenheit der Modelle gegenüber Menschen auf klar abgegrenzte Anwendungsfälle beschränkt, „Halluzinationen“, also irreführende Resultate der KI, bleiben ein regelmäßiges Problem. Daher findet der Einsatz von KI weiter nur innerhalb klarer Regelwerke und unter menschlicher Supervision statt. Sie bleibt auch in dem Sinne eine „gewöhnliche“ Technologie, dass ihre Verbreitung wie bei vorherigen Technologien nicht schlagartig, sondern sukzessive erfolgt; in dem Grad, in dem Lösungen reifer werden und Unternehmen, Gesellschaft und Politik die Risiken und Schwächen einzuschätzen lernen.
3. Ernüchternd: Der zuletzt explosive Fortschritt der Fähigkeiten großer KI-Modelle hat einen Sättigungspunkt erreicht. Die sogenannten „Scaling Laws“ stoßen an Grenzen. Das bedeutet, die Idee, dass immer mehr Rechenleistung die Modelle immer weiter verbessert, scheitert unter anderem an der begrenzten Verfügbarkeit qualitativ hochwertiger Daten zum Trainieren. Möglicherweise wurden die im Internet verfügbaren Daten gar zunehmend durch KI-generierte Inhalte „verseucht“, und die Zuverlässigkeit der Modelle nimmt dadurch ab. Damit bleiben sie zwar hilfreich für erste Entwürfe oder Denkanstöße, haben aber in der Summe nur begrenzte Auswirkungen auf die Arbeitsproduktivität.
Für alle drei Szenarien gibt es plausible Argumente, die auch schon in unterschiedlichen Variationen von führenden Denkern in diesem Bereich vorgetragen wurden. Doch eine Einschätzung der Eintrittswahrscheinlichkeiten wird erheblich dadurch erschwert, dass gerade im Bereich der generativen Modelle nicht einmal ihren Schöpfern deren genaue Funktionsweise bekannt ist. Denn diese Modelle werden nicht „gebaut“, sie werden „gezüchtet“. Sie wachsen also beim Training auf Basis der Daten, mit denen sie gefüttert werden. Ihre Entwicklung kann daher ähnlich wie beim Wachstum eines biologischen Organismus nicht präzise vorhergesagt werden.
Der Aktienmarkt unterstellt „Gewaltiges“
Insbesondere mit Blick auf die Bewertungen vieler „Ausrüster“ wie Nvidia und „Goldgräber“ wie Oracle, als auch auf die Kurssprünge einzelner „Goldgräber“-Aktien infolge von Ankündigungen neuer, riesiger Investitionssummen, scheinen Marktteilnehmer aus unserer Sicht Szenario (1) eine signifikante Eintrittswahrscheinlichkeit beizumessen – also von einer gewaltigen Entwicklung der KI auszugehen, deren Fähigkeiten schon bald und in den meisten Feldern „übermenschlich“ werden. Auch wenn die Grenzen zwischen den Szenarien fließend verlaufen, dürfte nur hier genug „Gold“ zu Tage gebracht werden können, um den „Goldrausch“ noch länger aufrecht zu erhalten.
Tatsächlich gibt es zahlreiche prominente Fürsprecher dieser Entwicklung – darunter Gründer von extrem erfolgreichen, innovativen Unternehmen wie Jensen Huang (Nvidia), Sam Altman (OpenAI), Larry Ellison (Oracle), Elon Musk (Tesla) oder Mark Zuckerberg (Meta). In der Vergangenheit hat es sich ausgezahlt, die Visionen der genannten Personen ernst zu nehmen. Man sollte allerdings auch im Hinterkopf behalten, dass alle ein starkes Interesse daran haben, dass lieber zu viel, als zu wenig in den Ausbau der physischen KI-Infrastruktur investiert wird.
Modellbauer wollen nicht durch Engpässe eingebremst werden und Überkapazitäten bei den „Zulieferern“ der Rechenleistung würden für niedrigere laufende Modellkosten sorgen. Ausrüster von Datenzentren, wie der Chiphersteller Nvidia, haben großes Interesse daran, dass keine Flaschenhälse in anderen Bereichen der Wertschöpfungskette – beispielsweise in der Stromerzeugung – ihren Absatz mindern. Zudem scheinen sich einige der heutigen Tech-Giganten in der spieltheoretischen Situation eines Gefangenen-Dilemmas zu wähnen: Wer nicht über eine immense physische Infrastruktur verfügt, könnte im KI-Rennen dauerhaft abgehängt werden. Selbst eine geringe Aussicht auf Erfolg kann also die hohen Investitionen sinnvoll erscheinen lassen, solange die Konkurrenten mit „Vollgas voraus“ fahren. Diese hohen Investitionen wiederum machen Fortschritte bei KI wahrscheinlicher.
„Normale“ Entwicklung historisch wahrscheinlicher
Zusamenfassend teilen wir die Sorgen um eine Blase, und historische Erfahrungen lassen es aus unserer Sicht wahrscheinlich erscheinen, dass der „Goldrausch“ zumindest zwischenzeitlich herbe Dämpfer erfährt, mit entsprechenden Verlusten bei zuvor übereuphorischen Investoren. Ebenso scheint Szenario (2) vor dem Hintergrund der Historie mittelfristig für uns die höchste Wahrscheinlichkeit zu haben.
Angesichts der beschriebenen Gemengelage wäre es jedoch aus unserer Sicht für eine umsichtige Anlagestrategie fahrlässig, pointiert auf oder gegen eines dieser Szenarien zu setzen. Wir versuchen vielmehr durch kluge Diversifikation dafür Sorge zu tragen, dass keines der drei Szenarien unseren Anlegern einen Schiffbruch beschert, ohne dabei die Chancen zu vernachlässigen. Hierbei sind die potenziellen Auswirkungen auf die Gewinnentwicklung unserer Beteiligungen ebenso wichtig wie die Frage, welche Hoffnungen und Ängste bereits in den Aktienkursen eingepreist sind.
Wer würde profitieren und was wären die Risiken?
Im Szenario (1) der „gewaltigen KI“ dürfte der Investitionsboom bei Datenzentren mit hohen Wachstumsraten weitergehen. Dies sollte für Ausrüster von Halbleiterherstellern oder Datenzentren von Vorteil sein. Auch große Cloud-Anbieter dürften auf ihre hohen Kapitalausgaben eine attraktive Rendite erwirtschaften. Zumal sie meist an führenden Sprachmodellen beteiligt sind.
Nach vorne blickend muss man aber auch konstatieren, dass das Szenario (1) in seiner genauen Entfaltung mit der höchsten Unsicherheit behaftet ist. Wird etwa ein KI-Modell alle anderen abhängen – beispielsweise, weil das erste wirklich „übermenschliche“ Modell lernt, sich selbst immer schneller zu verbessern oder könnten immer mächtigere Modelle nicht nur bessere Software, sondern auch bessere Hardware entwerfen – und damit beispielsweise die aktuellen Hersteller von KI-Chips verdrängen?
Oder gar für solche Sprünge in der Modelleffizienz sorgen, dass viel weniger – oder andere – Datencenterkapazitäten benötigt werden? Wie reagiert die Politik, wenn einzelne Unternehmen plötzlich über nie dagewesene Macht verfügen? Dürften sie dann noch in privater Hand bleiben? Wir können darauf keine klaren Antworten geben. Die Überlegungen gebieten daher aus unserer Sicht eine gesunde Portion Demut bei der Bewertung der Wachstumsaussichten potenzieller KI-Gewinner.
Zudem könnten allzu mächtige KI-Modelle möglicherweise die hochprofitablen Kerngeschäfte von Alphabet und Microsoft – Internet-Suche beziehungsweise Unternehmenssoftware – angreifbar machen. Vor diesem Hintergrund könnten, wie bereits beschrieben, auch die Geschäftsmodelle einiger der größten US-Technologieunternehmen im Szenario (1) unter Druck geraten.
In Szenario (2) – „KI als normale Technologie“ – könnten die letztgenannten Firmen aus unserer Sicht potenziell sogar deutliche Profiteure sein. Wenn KI nicht mit einem großen Knall, sondern sukzessive in Unternehmensprozesse einzöge, wären IT-Beratungsgesellschaften sowie etablierte Unternehmenssoftwareanbieter in einer hervorragenden Position, selbst die Implementierung von KI-Lösungen wie Agenten voranzutreiben. Basierend auf ihrem tiefen Verständnis von Prozessen und Daten und natürlich nicht zuletzt aufgrund ihrer starken Kundenbeziehungen und dem damit einhergehenden Vertrauen.
Wie könnte sich hingegen das Szenario (3) auswirken? Am schlimmsten wäre es wohl für unsere bisherigen „KI-Gewinner“, die den aktuell in ihren Aktienkursen reflektierten Wachstumshoffnungen nicht gerecht werden dürften. Allerdings haben alle Unternehmen auch außerhalb des KI-Booms große, hochprofitable Geschäfte. Die Fallhöhe wäre also schmerzhaft, aber nicht existenziell.
Diversifikation ist für uns essenziell
Es gibt aber auch eine Gruppe von Beteiligungen, die von keinem der Szenarien wesentlich berührt sein sollte. Konsumgüterhersteller wie Unilever oder McDonalds sollten ebenso wenig betroffen sein wie der Geschmack- und Duftstoffhersteller Symrise, der die erstgenannten Unternehmen beliefert. Denn welche Fähigkeiten KI-Modelle auch entwickeln, es scheint unwahrscheinlich, dass sie einen wesentlichen Einfluss darauf haben, wie oft Menschen Deo oder Weichspüler benutzen oder wie viele Hamburger sie essen.
Es gibt noch weitere Gruppen von Beteiligungen, die sich weniger leicht in die Szenarien einordnen lassen, aber bezüglich der möglichen Auswirkungen von KI auch ein sehr heterogenes Bild abgeben – mit Chancen ebenso wie Risiken. Dies soll auch keineswegs eine erschöpfende Analyse der Implikationen aus der Entwicklung von KI für Anleger sein. Es soll aber aufzeigen, wie vielfältig die Chancen und Risiken jeweils wirken könnten, und welch hohe Bedeutung wir einer gesunden Diversifikation beimessen.
Glossar
Verschiedene Fachbegriffe aus der Welt der Finanzen finden Sie in unserem Glossar erklärt.
RECHTLICHER HINWEIS
Diese Veröffentlichung dient unter anderem als Werbemitteilung.
Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen von Flossbach von Storch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Zukunftserwartung von Flossbach von Storch wider, können aber erheblich von den tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnissen abweichen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann keine Gewähr übernommen werden. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück.
Mit dieser Veröffentlichung wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen unter anderem keine individuelle Anlageberatung.
Diese Veröffentlichung unterliegt urheber-, marken- und gewerblichen Schutzrechten. Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Bereithaltung zum Abruf oder Online-Zugänglichmachung (Übernahme in andere Webseite) der Veröffentlichung ganz oder teilweise, in veränderter oder unveränderter Form ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Flossbach von Storch zulässig.
Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.
© 2025 Flossbach von Storch. Alle Rechte vorbehalten.